402. Scooter adventure dreams
A number of years ago I read the book “Long Way Round” by Ewan McGregor and Charlie Boorman. It tells of their adventures riding motorbikes from London to New York through Europe, Asia and North…
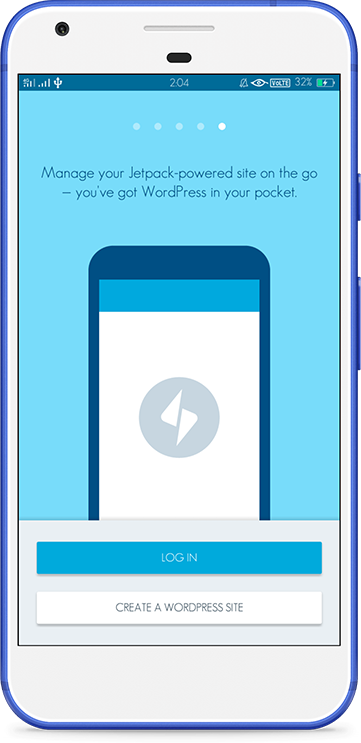
独家优惠奖金 100% 高达 1 BTC + 180 免费旋转
Frauen in Serien
Von Annett Scheffel
Im Kosmos der filmischen Bilder ist es oft wie im echten Leben: ein Moment, ein Satz, Blick oder Gedanke kann alles verändern. Manchmal sogar die Welt. Einen dieser kleinen großen Momente gibt es am Ende der vierten Staffel der US-Serie „House of Cards“. Es ist die spannungsreiche Verlagerung eines raffinierten Tricks, der von Anfang an eine Besonderheit der Serie ist: Der Politiker Frank Underwood, gespielt von Kevin Spacey, blickt immer wieder frontal in die Kamera — dem Zuschauer direkt in die Augen. Dann hält er kurze Ansprachen über die Feinheiten des Politbetriebs in Washington und seine Strategien zur Macht. Im Theater nennt man die Grenze, die er damit übertritt, die vierte Wand. Der Zuschauer wird so zu seinem Komplizen.
Dann plötzlich richtet auch seine Frau den Blick in die Kamera: Claire Underwood, die sich aus der Rolle der First Lady erfolgreich ins Amt der Vizepräsidentin hochgearbeitet hat, wird zu einem zweiten, gleichberechtigten Machtzentrum, um die die ganze Serie rotiert. Man mag das vielleicht nicht auf Anhieb verstehen, aber das ist ein zentraler Wendepunkt. Claire ist — genau wie ihr Mann — ein skrupelloser Machtmensch und gleichzeitig eine große Feministin, die auf ihrer Teilhabe an der Macht besteht. Ein paar Folgen später wird sie sogar selbst zur Präsidentin, so wie Hillary Clinton es fast geworden wäre. Die Fiktion ist hier wie so oft einen Schritt weiter als die Wirklichkeit. Ein Umstand, der nicht nur für „House of Cards“ gilt, sondern für viele neuere Politserien.
Fragt man Grundschulkinder, was sie werden wollen, wenn sie groß sind, wird sich die Antwort Präsident/in oder Regierungschef/in sich ziemlich gleichmäßig auf Mädchen und Jungen verteilen. Doch in den darauffolgenden Jahren verändert sich dieses Verhältnis: Mädchen beobachten die Welt um sich herum — die Gesichter in den Nachrichten, die Erwachsenen in ihrer Umgebung, die Figuren im Fernsehen. Und wenn aus den ehemaligen Grundschulkindern 15-jährige Jugendliche geworden sind, kommt dieselbe Antwort nur noch von sehr viel weniger Mädchen als Jungen. Filme und Serien haben darauf einen entscheidenden Effekt, denn: „Man kann nicht sein, was man nicht sieht.” So formuliert es Marie Wilson, Gründerin der amerikanischen Non-Profit-Organisation The White House Project. Wilson hat es sich zur Aufgabe gemacht, die weibliche Führungslücke zu schließen, — Why Women Can and Must Help Run the World — lautet der Untertitel eines ihrer Bücher.
Filmische Bilder sind ein wichtiger Bestandteil dieses endlosen und undurchdringlichen Gewebes, das wir Kultur nennen. Was wir in Filmen und Serien sehen, formt unsere Vorstellungen davon, wer wir sind, was möglich ist in diesem Leben, was man erwarten kann und was es bedeutet, eine Frau oder ein Mann zu sein. „Life imitates Art“, schrieb schon Oscar Wilde. Und der amerikanische Yale-Professor, Literaturkritiker und Gesellschaftstheoretiker Michael D. Warner hat für diesen Vorgang den schönen Begriff „poetic world making“ geprägt. In der Fantasie von Kreativen entstehen neue Welten, und diese Welten nehmen Einfluss auf die Realität. Das Selbstbild von Frauen wird daher — zumindest zu einem gewissen Grad — von dem geprägt, was sie in Filmen sehen: Wenn es dort an starken, mächtigen, komplexen Frauenfiguren fehlt, fällt es auch realen Frauen schwerer, sich selbst so zu sehen und zu denken.
Lange Zeit ging das, was die Zuschauer im Fernsehen angeboten bekamen, nicht weit über weibliche Stereotype hinaus. Ein Blick auf die Serien im US-Fernsehen zeigt, dass erst in den 70er-Jahren — parallel zur zweiten Welle der Frauenbewegung — eine zaghafte Erweiterung der im Fernsehen repräsentierten Rollenbilder einsetzte: Neben der traditionellen Mutterfigur gab es nun auch die Frau am Arbeitsplatz („Mary Tyler Moore Show“) und — vor allem seit den 90er-Jahren — die Single-Frau („Friends“, „Sex and the City“). Eines aber blieb fast immer gleich: Spätestens am Ende der Serie hatten die Frauen eine Familie gegründet oder zumindest einen passenden Partner gefunden — wenn alles gut ging, ohne auf ihre Karriere zu verzichten.
Ob Zufall oder nicht, die immer lauter werdenden Forderungen nach einer höheren Repräsentation von Frauen im Fernsehen sind in den letzten Jahren mit einem gesteigerten Interesse des Serienpublikums an politischen Inhalten zusammengefallen. Ob „House of Cards“ oder „Scandal“, ob „The Good Wife” oder „Borgen” — immer mehr Serien kreisen um das Feld der Politik als Sujet, um politische Akteure als Charaktere oder politische Prozesse als Handlungen. Geschichten über das entschlossene Streben nach Macht sind natürlich uralt. Neu aber ist die Bereitschaft des Zuschauers, sich mit komplizierten, machiavellistisch anmutenden politischen Zusammenhängen auseinanderzusetzen. Eingeläutet wurde diese Verschiebung besonders von zwei Serien, die 1999 im US-Fernsehen starteten: die sich in komplexen Erzählsträngen entwickelnde Mafiaserie „The Sopranos“ (1999–2007) und die White-House-Saga „The West Wing“ (1999–2006) mit ihren lang angelegten Spannungsbögen und überraschenden Wendungen. Aber auch in diesen beiden Fällen blieben die Handlungsszenarien männlich dominiert. Und so unterschiedlich die Helden dieser beiden Serien sind, beide sind vor allem eins: Männer in Machtpositionen.
In „The Sopranos“ gerät der amerikanische Mafioso Tony in eine seelische Krise und muss in der Folge das kultivierte Ausleuchten seines Innenlebens im Rahmen einer Psychotherapie mit dem brutalen Mafia-Alltag unter einen Hut bringen. Tonys Serienwelt funktioniert nach den Konventionen des von machohafter Männlichkeit strotzenden amerikanischen Gangsterfilms. Mit Weiblichkeit assoziierte Emotionen werden hier mit aller Kraft unterdrückt und verheimlicht, bis zu dem Punkt, an dem sie unkontrolliert hervorbrechen. „The West Wing“ wiederum handelt vom fiktiven US-Präsident Josiah Bartlet, den Martin Sheen als idealistischen, bibelfrommen Menschenfreund spielt: ein Entscheider mit einer Vision für die Zukunft; ein Guter, der für das Gute kämpft. Toughe Frauen gibt es im Westflügel von Josiahs Weißem Haus zwar auch — die wortgewandte Regierungssprecherin, die als Ärztin arbeitende First Lady — nie aber stehen sie im Zentrum der Erzählung oder gelangen in wirklich hohe Machtpositionen. Machiavelli war ein Mann, der Gangsterboss und der Präsident sind Männer geblieben.
Genau das hat sich mit der neuen Generation der Polit-Serien nun gewandelt: Sehr viele dieser neuen Serien richten den Fokus auf starke, weibliche Hauptfiguren. Fast scheint es so, als hätten sich die Serienmacher jenen Monolog zum Mantra gemacht, mit dem die Schauspielerin Amy Poehler in der Rolle der Lokalpolitikerin Leslie Knope in der ersten Folge von „Parks and Recreation“ (2009–2015) den Zuschauer begrüßte: „You know, government isn’t just a boys club anymore. Women are everywhere. It’s a great time to be a woman in politics!“ In den neuen Serien kann man sich die ganze Bandbreite an Rollen anschauen, die Frauen in der Politik spielen können — Präsidentin, Außenministerin, Krisenmanagerin. Zudem lässt sich erahnen, wie eine Welt mit mehr Frauen in Machtpositionen aussehen könnte. Und das Bild, das wir bekommen, ist ziemlich vielfältig. Denn interessanterweise unterscheiden sich die Frauenfiguren stark voneinander.
In „Scandal“ (seit 2012) sehen wir Kerry Washington als krisenmanagende Strippenzieherin hinter den Kulissen, die darauf spezialisiert ist, die Polit-Karrieren in Washington vor Skandalen zu bewahren. Julianna Margulies spielt in „The Good Wife“ (2009–2016) Alicia Florrick: Als Ehefrau eines in Ungnade gefallenen Staatsanwalts, der eine Gefängnisstrafe absitzt, muss sie sich zunächst als Anwältin in einer neuen Kanzlei durchbeißen, bevor sie später ihre eigene gründet. In dem Netflix-Erfolg „House of Cards“ (seit 2013) spielt Robin Wright neben Kevin Spacey eine der beiden Hauptrollen. Als eine Hälfte des machthungrigen, skrupellosen Politiker-Paares Claire und Frank Underwood geht ihre Rolle über die der hübschen Präsidentengattin weit hinaus: Im Laufe der Serie entwickelt sie sich zunächst von einer eiskalten Lobbyistin zur UN-Botschafterin, später zur US-Vizepräsidentin und schließlich sogar zur Präsidentin. Frisch berufene US-Außenministerin ist dagegen die von Téa Leoni dargestellte Figur Elizabeth McCord in „Madame Secretary“ (seit 2014): Sie ist charmant und integer und setzt sich als geborene Diplomatin in internationalen Krisen ebenso souverän durch wie im Büroalltag gegen intrigante Widersacher. Und schließlich wäre da noch Sidse Babett Knudsen als dänische Premierministerin Birgitte Nyborg, die in „Borgen“ (2010–2013) zwischen Machtspielen und Familienalltag einen verlustreichen Kampf für ihre Ideale führt.
Damit unterscheiden sich die neuen Frauenrollen radikal von denen des frühen Fernsehkosmos: diese Frauen haben ganz selbstverständlich Berufe, wichtige Berufe, „Männerberufe“. Und — wie im Fall von „The Good Wife“ — haben sie sogar Beruf, Kinder und Privatleben. Verrückterweise war das, als die Serie 2009 startete, noch eine echte Seltenheit: ein Role-Model mit Brüchen. Alicia ist Mutter, Alicia ist schlau, Alicia wartet nicht, dass sie etwas bekommt, sie fordert es ein. Interessant ist das vor allem, weil die Protagonistin Alicia Florrick zunächst einmal über ihren Mann definiert wird: Sie ist, wie der Serientitel suggeriert, eine gute Ehefrau. In dieser Rolle erträgt sie die Korruptions- und Prostitutionsskandale ihres Mannes, einem erfolgreichen Staatsanwalt und späteren Gouverneur. So wie Hillary Clinton nach dessen Affäre zu Bill gehalten hat, steht auch Alicia zu ihrem Mann. Das ist der Ausgangspunkt. Das eigentliche Thema ist aber die Entwicklung der guten Ehefrau, als die Alicia in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, hin zu einer Person, die Anspruch auf eine eigene Identität und eigene Macht erhebt.
Apropos Hillary Clinton: Es ist ein augenscheinliches Phänomen, dass die ehemalige US-Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin wie ein Spukgespenst — oder besser: Schutzgeist? — durch die neuen Polit-Serien zu schweben scheint. Wir denken an Hillary, wenn Alicia Florrick in „The Good Wife“ mit eiserner Miene die in die Medien gezerrten Sexeskapaden ihres Mannes erträgt, wenn sie zu ihrem Mann sagt, „I may need you, but you sure as hell need me too“. Wir denken an Hillary, wenn Außenministerin Elizabeth McCord in „Madame Secretary“ bei Meetings immer diejenige ist, die sich am besten vorbereitet hat. Und wir denken an Hillary, wenn Claire Underwood sich in „House of Cards“ langsam, aber mit unbändigem Willen und Beharrlichkeit, aus der Rolle der Ehefrau an der Seitenlinie befreit und ihren Platz im Zentrum des Polit-Geschehens einfordert. Hillary, die Politikerfrau, die Aufsteigerin, die tüchtige Karrierefrau, die erste weibliche amerikanische Präsidentschaftskandidatin. In den Bildern dieser fiktionalen Serien schimmern die Versatzstücke der realen Biografie von Hillary Clinton durch. Mit jeder Wiederholung und Variation dieser und ähnlicher Bilder dringen sie tiefer ins kulturelle Gedächtnis des Publikums ein. Und bevor Clinton die US-Wahlen verlor, waren diese Serien auch eine Art imaginärer Testlauf: Wie wäre es, wenn eine Frau im Oval Office säße?
Wenn man davon ausgeht, dass die Art und Weise, wie politische Macht — besonders in Amerika — erzählt und inszeniert wird, großen Einfluss auf die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Realität im Land hat, dann lohnt es sich, einen genaueren Blick auf „Scandal“ zu werfen. Im Zentrum von Shonda Rhimes Serie steht die Figur Olivia Pope — Nomen est omen. Olivia dirigiert als Chefin einer Agentur für Politikberatung hinter den Kulissen die Schicksale der politischen Entscheidungsträger Washingtons. Ihr Job besteht unter anderem darin, den Präsidenten, mit dem sie auch eine Affäre hat, vor Skandalen zu schützen. Themen wie Schwangerschaft, Mutterschaft und Familie werden in „Scandal“ ganz anders behandelt als in konventionellen Formaten: Denn Olivia verkörpert — trotz ihrer Affäre — das komplette Gegenteil eines klischeehaft wiederkehrenden Typs Serienfrau, der spätestens mit Abschluss der letzten Staffel in festen Händen, schwanger oder verheiratet ist. Die Figur ist so angelegt, dass man sie nie auf eine ausschließlich private Funktion reduzieren kann. Ihre Karriere ist ein zentraler Bestandteil ihrer Person. Das Bild von sich als brave, Marmelade kochende Hausfrau, das sie in romantischen Momenten selbst heraufbeschwört, nimmt ihr der Zuschauer nie wirklich ab. Sie ist keine klassische, moralisch einwandfreie Heldin, sondern eine komplexe Figur, die damit der Realität viel näherkommt.
Ohnehin spart „Scandal“ die Realität nicht aus und verarbeitet immer wieder politische Ereignisse und Debatten der Gegenwart (NSA-Affäre, die Unruhen in Ferguson), was für den Zuschauer den Zugang erleichtert. Sie sehen eine Welt, die ihnen bekannt vorkommt. Gleichzeitig ist diese Welt im Hinblick auf Gleichberechtigung und Toleranz unserer Realität einige Schritte voraus, insofern Frauen und andere Minderheiten in der Politik völlig selbstverständlich sind.
Doch verlassen wir nun die USA und wenden uns zum Schluss einer europäischen Produktion zu, nämlich der dänischen TV-Serie „Borgen“. Deren Hauptfigur steigt zwischen Männern bis zur Regierungschefin auf und ist plötzlich alles zugleich: Mutter, Premierministerin, Machtmensch — sexy, durchsetzungsfähig und sensibel. „Borgen“ seziert sehr viel genauer als die zuvor genannten Serien die moralischen Fallstricke einer weiblichen Politkarriere. Birgitte Nyborg muss sich fragen, wie viel Integrität und moralische Prinzipien sie sich auf diesem Weg bewahren kann und wie vereinbar der Alltag einer Kleinfamilie mit den Aufgaben einer Staatschefin ist. Birgittes Mann verzichtet in der Serie auf seine Karriere und kümmert sich um die Kinder. „Borgen“ zeigt uns also eine Frau, die Karriere machen kann, weil ihr ein unterstützender Mann den Rücken stärkt. Mit Politik hat dieser Umstand im Grunde zunächst einmal gar nichts zu tun, doch durch sie wird das Familienleben verkompliziert; es erscheint als instabiles Gefüge, das inmitten des harten Polit-Geschäfts viele Fragen aufwirft: Wie viel verlangt der demokratische Dauerkampf seinen Protagonisten ab? Was ist ein guter Kompromiss? Kann man eine gute Mutter und eine gute Politikerin sein? Macht Macht mit Frauen etwas anderes als mit Männern? Diese und ähnliche Fragen machen „Borgen“ zu einer hochkomplexen Auseinandersetzung mit dem Thema Macht und schärfen gleichzeitig den Blick für moderne Geschlechterbilder. In Dänemark wurde übrigens ein Jahr nach dem Serienstart mit Helle Thorning-Schmidt auch in der Realität die erste Frau Regierungschefin.
Mit ihrer Darstellung von Frauen in machtpolitischen Strukturen spielen die genannten Serien eine wichtige Vermittlerrolle, wenn es darum geht, überholte Geschlechterstereotypen zu überwinden: weil sie Bilder von Frauen in hohen und höchsten politischen Ämtern normalisieren und gleichzeitig als Was-wäre-wenn-Szenarien Anreize schaffen, die Gegenwart und ihre Möglichkeiten neu zu denken. Die Wirklichkeit sieht hingegen auch im Jahr 2017 noch ziemlich ernüchternd aus: Das UN-Frauennetzwerk Council Of Women World Leaders hat ausgerechnet, dass weltweit nur 22,8 Prozent Frauen in den nationalen Parlamenten sitzen (Stand Juni 2016, den höchsten Frauenanteil hat übrigens das ostafrikanische Land Ruanda) und es nur zehn weibliche Staatsoberhäupter und neun Regierungschefinnen gibt (Stand Januar 2017).
Gerade weil es Serienmachern wie Shonda Rhimes gelingt, politische Prozesse greifbar zu machen, ohne den Unterhaltungswert zu vernachlässigen, dringen diese Geschichten tief ins Bewusstsein der Zuschauer ein: Die smarten, witzigen, kompetenten, durchsetzungsfähigen, aber eben auch nicht perfekten Frauenfiguren in den beschriebenen Serien sind wunderbar wirkungsvolle Image-Kampagnen: Sie werben mit sehr unterschiedlichen Role-Models — wie der Außenministerin Elizabeth McCord, Präsidentin Claire Underwood und Premierministerin Birgitte Nyborg — für starke Frauen in den Regierungen. Man könnte das Ganze auch unter dem Slogan zusammenfassen: „Make the World reeeaaally great again!“ — nur ohne diese bescheuerten Trump-Kappen und dafür mit weiblicher Empathie, Raffinesse und Verhandlungsgeschick. Poetic world making. Das Leben imitiert die Kunst. Die Fiktion erzeugt die Welt. In dieser Welt wären Frauen in den entscheidenden politischen Positionen eine Selbstverständlichkeit. Und der Großteil der Gesellschaft würde ebenso selbstverständlich davon ausgehen, dass sie ihren Job mindestens so gut machen wie die Männer. Wie eine Welt mit mehr Frauen in Machtposition aussehen könnte, sieht man in den neuen Politserien. Auch diese Welt wäre nicht perfekt, aber offener für verschiedene Stimmen.
Related posts:
LIBERDADE
Ontem foi um dia massa!. “LIBERDADE” is published by Ene Kuesta.
Is Suicide Selfish?
Is suicide selfish? I’ve seen it said over and over again, in the light of Kate Spade and Anthony Bourdain’s suicides, that suicide is selfish. Here is my answer. This pertains to suicides born out…
What the dickens is an API?
Your tech person says these dreaded 3 letters in every meeting, as if talking about something as understandable as jam. And you sit there nodding. The panic sets in. It has been said so many times…